
News & Trends
Deadphones: Die zehn beliebtesten Todesarten von Kopfhörern
von David Lee

Wenn ein Gerät zeitgleich mit dem Ende der Garantie hopsgeht, mögen viele nicht an Zufall glauben. Bauen die Hersteller ein Ablaufdatum in ihre Produkte ein? Beweisen lässt sich das in der Regel nicht. Aber es gibt andere Mittel gegen die Kurzlebigkeit.
Dinge gehen kaputt. Oft viel zu früh und obendrein aus unerfindlichen oder läppischen Gründen. Ein Plastikteilchen bricht ab. Ein Transistor schmort durch. Das Netzteil steigt aus. Ein Dichtungsring rinnt. Und obwohl der Rest noch in Ordnung wäre, lässt sich das Gerät nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand reparieren.
In solchen Fällen kommt schnell der Verdacht auf, der Hersteller mache das mit Absicht. So erging es mir, als die Taste im Titelbild oben abbrach. Die besteht nämlich nur aus einem fixierten Stück Kunststoff ohne Scharnier, das bei jeder Betätigung bewegt wird. Logisch, dass das irgendwann abbricht; wahrscheinlich kann man mit Materialermüdungstests sogar ziemlich genau bestimmen, wann es den Geist aufgeben wird.
Viele User haben den Eindruck, dass ihre Geräte mit schöner Regelmässigkeit kurz nach Ablauf der Garantie kaputt gehen. So auch BasementKid, dessen Review eines Apple Macbooks derzeit auf vielen Plakaten zu sehen ist.
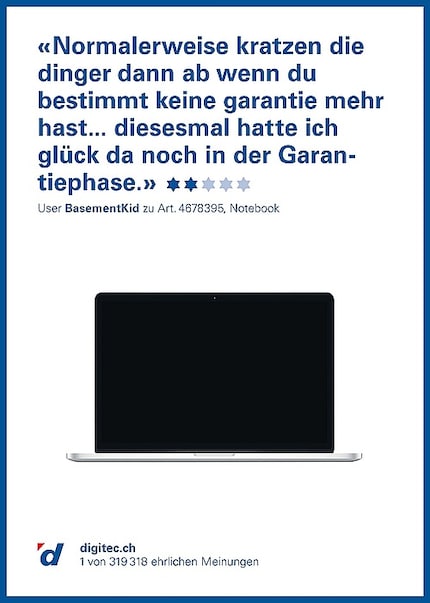
Zufall oder Absicht? Eine absichtliche Verkürzung der Lebensdauer, um mehr Ersatzprodukte zu verkaufen, nennt sich «geplante Obsoleszenz». Du hast den Begriff wahrscheinlich schon gehört. Er ist zu einem beliebten Stammtischthema geworden, auch wenn ihn spätestens nach dem dritten Bier niemand mehr korrekt aussprechen kann.
Beliebt ist er auch bei den User-Kommentaren. Google liefert aktuell 186 Treffer für die Site digitec.ch mit dem Begriff «geplante Obsoleszenz». Die User wittern böse Absicht bei Druckern, Grafikkarten, Computermäusen, Tastaturen oder Ladegeräten – also praktisch überall.
Geplante Obsoleszenz kann auf die unterschiedlichsten Arten geschehen. Zum Beispiel werden Verschleissteile so eingebaut, dass sie nicht ausgetauscht werden können; bekannte Schwachstellen werden absichtlich nicht verstärkt; oder die Produkte werden bewusst so gemacht, dass sie technisch schnell veralten.
Trotzdem kommt beim Thema geplante Obsoleszenz immer das gleiche Beispiel: Das Glühbirnen-Kartell aus der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Damals hatten führende Lampenhersteller wie Philips, Osram oder General Electric untereinander ausgemacht, die Lebensdauer einer Glühbirne auf 1000 Stunden zu beschränken. Was auch gelang.
Warum wird immer und immer wieder das alte Beispiel mit den Glühbirnen aufgetischt? Ganz einfach: Weil es eines der wenigen ist, bei denen sich geplante Obsoleszenz nachweisen lässt. Denn das Glühbirnen-Kartell führte Buch und verhängte bei Missachtung der Abmachungen Geldstrafen. Dazu gibt es schriftliche Dokumente und die Firmen wurden auch verurteilt.
Im Normalfall jedoch lässt sich geplante Obsoleszenz nicht nachweisen. Du kannst zwar einschätzen, ob die Konstruktion eines Geräts der Lebensdauer förderlich ist oder nicht. Was sich aber nicht nachweisen lässt: Ob die Schwachstellen absichtlich eingebaut wurden. Denn es gibt fast immer auch andere Erklärungen, weshalb ein Hersteller sein Produkt genau so und nicht anders gebaut hat. Bei komplexen Hightech-Produkten sowieso.
Einige Beispiele:
Die abgebrochene Taste im Titelbild könnte auch einfach fix montiert worden sein, weil das die einfachste und billigste Konstruktion ist.
Ein Akku, der fest verbaut ist und sich nicht oder nur mit riesigem Aufwand auswechseln lässt, könnte als geplante Obsoleszenz ausgelegt werden. Denn das Gerät wird unbrauchbar, wenn der Akku altersschwach wird. Andererseits ermöglicht der feste Einbau eine nahtlose Oberfläche und damit ein schöneres Design. Ausserdem ist das Gehäuse besser gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt.
Viele Elektronikgeräte enthalten billige Kondensatoren, die nach einigen Jahren hinüber sind. Ein langlebiger Kondensator wäre teurer, aber nicht viel teurer. Ist das geplante Obsoleszenz oder einfach Kostenoptimierung? Warum sollte der Hersteller Geräte, die nach 5 Jahren veraltet sind, auf 20 Jahre Betriebszeit trimmen? Warum sollte es einen Hersteller jucken, wenn seine Navigationsgeräte nach 15 Jahren nicht mehr funktionieren? So lange benützt das Zeug sowieso kaum jemand.
Die meisten Smartphones haben keine austauschbaren Komponenten. Ist das nun geplante Obsoleszenz? Nicht unbedingt: Der Austausch von Komponenten kann auch schlicht sinnlos sein. Zum Beispiel, weil ein Flaschenhals entsteht, wenn die Komponenten nicht auf dem gleichen technischen Stand sind. So sympathisch die Idee des Fairphone ist, es zeigt auch, welche Probleme sich ergeben, wenn möglichst viele Komponenten auswechselbar sein sollen.
Ältere Geräte nicht mehr mit Updates zu versorgen, macht diese irgendwann unbrauchbar. Auch hier könnte man böse Absicht unterstellen. Es könnte aber auch sein, dass die Rechenleistung für die aktualisierte Software zu schwach ist. Oder dass es für den Hersteller zu aufwendig ist, sämtliche alten Modelle zu supporten.
Auch der Fall der Glühbirnen ist gar nicht so eindeutig wie er auf den ersten Blick scheint. Im Arte-Dokumentarfilm «Kaufen für die Müllhalde» wird eine Glühbirne gezeigt, die seit weit über hundert Jahren praktisch ununterbrochen brennt. Dieses «Centennial Light» ist weltberühmt und soll als Beleg herhalten, dass Glühbirnen langlebig sind. Was dabei aber nicht gesagt wird: Dass der Draht dieser 60-Watt-Glühbirne kaum Helligkeit spendet. Je heller eine Glühbirne bei gleichem Stromverbrauch leuchtet, desto schneller verglüht der Draht. Es gilt, einen sinnvollen Kompromiss zwischen Lebensdauer und Lichtausbeute zu finden.
Selbst wenn sich überhaupt keine sinnvolle Erklärung für eine Schwachstelle finden lässt, wäre das noch kein Beweis für eine böse Absicht. Vielleicht war der Produktentwickler einfach zu doof.
Da eine Absicht kaum zu beweisen ist, erstaunt es auch nicht, dass es in vielen Ländern kein gesetzliches Verbot gibt. Die Mitglieder des Glühbirnenkartells wurden nicht wegen geplanter Obsoleszenz verurteilt, sondern wegen Preisabsprachen und Wettbewerbsverzerrung. In Deutschland und in der Schweiz ist geplante Obsoleszenz nicht explizit verboten. Der Nationalrat hat 2012 einen entsprechenden parlamentarischen Vorstoss abgelehnt.
In Frankreich und Italien existieren jedoch seit wenigen Jahren Bestrebungen, die Hersteller zur Rechenschaft zu ziehen. Apple zum Beispiel wurde in Italien zu zehn Millionen Strafe verdonnert, weil die CPU der iPhones bei nachlassendem Akku gedrosselt wird.
Doch auch in diesem Fall ist nicht alles so eindeutig. Denn natürlich kann es durchaus im Sinne des Users sein, die Rechenleistung zu drosseln, damit das Smartphone bis am Ende des Tages durchhält. Andererseits: Wenn der User darüber nicht informiert wird und nicht selbst entscheiden kann, ob er das will, kann ihn die Massnahme zum frühzeitigen Kauf eines neuen Geräts bewegen.
Experten wie Christoph Hugi, Dozent für Nachhaltigkeit und Entwicklung an der Fachhochschule Nordwestschweiz, vermuten in den meisten Fällen keinen fiesen Masterplan, sondern einfach fehlendes Interesse des Herstellers an Langlebigkeit. Der Hersteller hat nichts davon, wenn er die Produkte langlebig konstruiert, also gibt er sich auch keine Mühe.
Letztlich ist es gar nicht nötig, dem Hersteller eine Absicht nachzuweisen. Was zählt, ist das Ergebnis. Wenn ein Gerät bei normalem Gebrauch innerhalb von zwei Jahren kaputt geht, ist das einfach nicht in Ordnung – egal, ob vom Hersteller beabsichtigt oder nicht.
Lange Garantiefristen sind daher das wirksamere Mittel als langwierige und komplizierte Gerichtsverfahren über geplante Obsoleszenz. Die Schweiz hat 2013 einen Schritt in diese Richtung gemacht und die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 12 auf 24 Monate verlängert.
Nach diesem Prinzip wären weitere Massnahmen denkbar. Etwa, dass Smartphones mindestens fünf Jahre mit Sicherheitsupdates versorgt werden müssen. Solche Gesetze müssten aber weltweit oder zumindest europaweit koordiniert werden. Ein Alleingang der Schweiz könnte dazu führen, dass die Hersteller den kleinen Schweizer Markt einfach nicht mehr beliefern.
Selbst der Nachweis einer unterdurchschnittlichen Lebensdauer – ob Absicht oder nicht – ist schwierig. Es müssten von jedem einzelnen Produkt genügend viele und verlässliche Daten erhoben werden. Solche Studien scheint es kaum zu geben. Die Stiftung Warentest führt gelegentlich grosse Nutzerumfragen zur Lebensdauer durch, doch bei den Notebooks beispielsweise ist die letzte Umfrage älter als zehn Jahre.
Diese Studie des deutschen Umweltbundesamtes von 2016 hält fest, dass die durchschnittliche Nutzungsdauer der Geräte tatsächlich gesunken ist. Allerdings nicht, weil die Geräte unbrauchbar werden, sondern weil die User keine Lust haben, alte Geräte weiter zu benutzen und sie sich etwas Neues kaufen, obwohl das Alte noch prima funktioniert.
Auch das kann natürlich vom Hersteller beabsichtigt sein. Durch den ständigen technischen Fortschritt ist ein fünf Jahre altes Notebook einfach nicht mehr attraktiv. Gegen solche Entwicklungen lässt sich kaum etwas einwenden. Anders sieht es aus, wenn ein Hersteller seine Innovationen absichtlich zurückhält und nur häppchenweise ausliefert, so dass der User jedes einzelne Gerät neu kaufen muss, um von allen bereits bekannten Innovationen zu profitieren. Diesen Verdacht hatte ich beispielsweise bei der ersten spiegellosen Systemkamera Panasonic G1. Die hatte keine Videofunktion, obwohl das jeder Billigknipser konnte und obwohl das technisch einer der grossen Vorteile gegenüber Spiegelreflexkameras ist. Ein halbes Jahr später kam dann die GH1 mit Video. Einen Beweis für das Zurückhalten von Innovation gibt es aber auch hier nicht.
Nicht alles lässt sich über gesetzliche Garantiefristen regeln, auch wenn dies ein sehr effektives Mittel gegen Kurzlebigkeit ist. Ein bisschen bist auch du als User in der Verantwortung. Du bestimmst mit, was auf dem Markt läuft. Wenn dein Smartphone noch gut funktioniert und es noch Sicherheitsupdates gibt, benutz es weiter – oder verkauf es wenigstens, damit es jemand anders weiter benutzen kann.
Durch Interesse an IT und Schreiben bin ich schon früh (2000) im Tech-Journalismus gelandet. Mich interessiert, wie man Technik benutzen kann, ohne selbst benutzt zu werden. Meine Freizeit ver(sch)wende ich am liebsten fürs Musikmachen, wo ich mässiges Talent mit übermässiger Begeisterung kompensiere.
Interessantes aus der Welt der Produkte, Blicke hinter die Kulissen von Herstellern und Portraits von interessanten Menschen.
Alle anzeigen
Hintergrund
von Dominik Bärlocher

Hintergrund
von Simon Balissat

Hintergrund
von Martin Jungfer